Der deutsche Wald wächst
Deutschland ist eines der waldreichsten Länder in der Europäischen Union. Wald![]() wächst hier auf mehr als 30 Prozent der Landesfläche. Und der Wald wächst weiter: In den vergangenen vier Jahrzehnten hat die Waldfläche um eine Millionen Hektar zugenommen, das entspricht zwei Millionen Fußballfeldern.
wächst hier auf mehr als 30 Prozent der Landesfläche. Und der Wald wächst weiter: In den vergangenen vier Jahrzehnten hat die Waldfläche um eine Millionen Hektar zugenommen, das entspricht zwei Millionen Fußballfeldern.

Nachzulesen sind diese Fakten im Waldbericht der Bundesregierung, dem das Bundeskabinett zugestimmt hat. Er informiert über die Wald-, Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland sowie über die Schwerpunkte der nationalen Forstpolitik und über die internationale Waldpolitik der Bundesregierung.
Wald mit vielen Gesichtern
Der Wald erfüllt viele Funktionen: Er ist Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, Holzproduzent, Erholungs- und Freizeitgebiet, Stickstoff-Speicher und Sauerstoffspender.
Dabei kann es zu Konflikten kommen. Freizeitaktivitäten und Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere sind nicht immer vereinbar.
Holzproduktion und –einschlag sind nicht für alle Menschen verständlich. Viele befürchten, dass der vermehrte Holzeinschlag der letzten Jahre zu einer Schädigung des Waldes führt. Zwar hat der Holzeinschlag von 39,5 Millionen Quadratmeter im Jahr 2001 auf 62,3 Millionen in 2006 zugenommen. Dennoch liegt er weiterhin unter dem Holzzuwachs. Jährlich wächst der Wald in Deutschland um durchschnittlich zehn Quadratmeter pro Hektar.
Die "Schädlinge des Waldes"
Vielmehr setzen dem Wald extreme Witterung, Schädlinge, Waldbrände und Klimawandel zu. So war zum Beispiel die Witterung im Zeitraum 2001 bis 2008 deutlich zu warm. Als Folge dünnten sich die Kronen der Bäume aus. Auch Stürme wie Kyrill Anfang 2007 richten langjährig anhaltende Schäden an. Zunehmend beeinträchtigen aber auch Insekten![]() und andere, fremde wärmeliebende Schädlinge die Stabilität der Wälder.
und andere, fremde wärmeliebende Schädlinge die Stabilität der Wälder.
Schaut man über die deutschen Grenzen hinaus, geraten große Abholzungsgebiete in den Tropen in den Blick. Jährlich werden hier 13 Millionen Hektar wertvoller Naturwälder insbesondere zerstört. Das entspricht etwa 35 Prozent der Fläche Deutschlands. Ursachen sind Armut, keine nachhaltige Landnutzung oder schwache Regierungsstrukturen.
Hinzu kommt die weltweite Nachfrage nach Lebens- und Futtermitteln sowie Bioenergie. Naturwälder werden in Entwicklungsländern in Ackerflächen umgewandelt. Die Folgen sind bekannt: Der Klimawandel wird verstärkt.
Der Wald braucht Schutz
Aus der Nutzung des Waldes und dem Klimawandel ergeben sich mannigfaltige Aufgaben für die Forstpolitik der Bundesregierung. In der Nationalen Strategie zur biologischen Artenvielfalt hat die Bundesregierung im Jahr 2007 die Bedeutung der Wälder betont. Deshalb sollen mit der Strategie großräumige, unzerschnittene Waldgebiete erhalten bleiben.
Bis 2010 soll ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Waldverjüngung und Wildbestand erreicht werden. Außerdem sollen private Waldbesitzer verpflichtet werden, zehn Prozent ihrer Flächen unter Naturschutz zu stellen. Insgesamt sollen 80 Prozent der gesamten Waldflächen bis zum Jahr 2010 nach hochwertigen ökologischen Standards zertifiziert werden.
Unter dem Motto "Holz![]() als Energieträger" strebt die Bundesregierung ein nachhaltiger Ausbau
als Energieträger" strebt die Bundesregierung ein nachhaltiger Ausbau![]() der energetischen Nutzung dieser Biomasse
der energetischen Nutzung dieser Biomasse![]() an. Deshalb werden beispielsweise Investitionskosten für Scheitholz-, Hackschnitzel- und Pelletheizungen gewährt.
an. Deshalb werden beispielsweise Investitionskosten für Scheitholz-, Hackschnitzel- und Pelletheizungen gewährt.
Gegenwärtig erarbeitet sie gemeinsam mit den Bundesländern, Nichtregierungsorganisationen und der Wissenschaft eine nationale Waldstrategie. Dabei geht es darum, Wege zu finden, wie der Wald zwar vielfältig, aber nachhaltig genutzt werden kann. Auch zukünftige Generationen sollen den Wald als Energiequelle, Baustoffproduzent und Erholungsort nutzen können.
- Autor:
- Holzi am 18. Jun. 2009 um 08:36 Uhr
- SChlagwort:
- Bericht | Deutschland | Wald
- Kategorie:
- Baum
- Trackback:
- http://www.holzwurm-page.de/trackback/2850
- Bookmark:

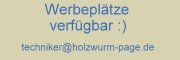
Kommentar hinzufügen